»Teilen und Haben«
MAGAZIN »Leben in der Frauenkirche« > HEFT 1/2024 > INHALT > Teilen und Haben
Teilen und Haben

Was, wenn wir Verteilung falsch verstehen? Und dadurch auch Verteilungsgerechtigkeit ständig falsch angehen? Denn das, was wir mit großzügigem Verzicht assoziieren, ist menschheitsgeschichtlich viel mehr eine Frage des Überlebens. An den Grenzen unserer Ressourcen müssen wir dringend lernen, es wieder so zu behandeln.
Die Welt ist ungerecht verteilt. Damit beginnen die meisten unserer Probleme. Ob Umwelt, Löhne, Lebenshaltungskosten, Migration oder Mieten – fast alle Streitigkeiten drehen sich darum, wer Macht und Ressourcen besitzt oder sich weigert, sie abzugeben. Umso dringlicher beschwören wir die Bereitschaft zu teilen. Brot zu brechen, oder auch mal Scheine, Trinkgeld oder Kleingeld geben, an die Tafel spenden, oder die Seenotrettung.
Das, was wir für uns selbst vornehmen und schon unseren Kindern in liebevoller pädagogischer Kleinarbeit versuchen zu vermitteln – ob mit St. Martin und Regenbogenfisch. Geben ist selbstlos, hilfreich oder gut und vor allem weitaus seliger denn Nehmen. Nur wer erklärt das jetzt Jeff Bezos?
Schere zwischen Arm und Reich
Seit 2000 Jahren predigen wir Großzügigkeit ziemlich vergeblich. Ungeachtet aller Erziehungsmethoden, Appelle und Spendenaufrufe ist die Schere zwischen Arm und Reich in den letzten Jahrzehnten immer weiter auseinander gegangen. Inzwischen klafft sie so weit auseinander, dass es ernsthaft die Demokratie gefährdet. In Deutschland ist eins von fünf Kindern armutsgefährdet und weltweit besitzen 8 Männer mehr Vermögen als die ganze untere Hälfte. Dabei versprechen Milliardäre doch regelmäßig, ihr Vermögen noch zu Lebzeiten wegzugeben, die Politik redet ohne Unterlass von Gerechtigkeit und Unternehmen davon, wie groß sie soziales Engagement schreiben.
Großzügigkeit ist in aller Munde, aber wenn man sich den Zustand der Welt anguckt, gleicht die Suche danach der nach einem Phantom. Auch in der Wissenschaft gelingt es oft nur, einen flüchtigen Blick darauf zu erhaschen: In den Achtzigern zeigten erste Experimente, dass Menschen von geschenkten 10 Euro im Schnitt drei an Unbekannte abgeben – dass fast niemand nichts gibt! – und wir waren davon angenehm überrascht. Besonders die Ökonomie, deren Erwartungen an Menschen berüchtigt gering sind. Wenig später entdeckte die Hirnforschung, dass Menschen auch Gedanken und Gefühle teilen. Oder, dass sie beim Geben eine angenehme Empfindung namens »warm glow« umgibt. Damit können wir uns der Seligkeit schon ziemlich nah fühlen. Aber leider nur, solange man dem Phantom nicht zu nah auf die Pelle rückt.
Wie ernst meinen wir es mit Großzügigkeit?
Bei Lichte betrachtet ist unsere Großzügigkeit erstaunlich wackelig. Anfällig für einfachste Ausreden oder Diskriminierung und Gruppendenken. Wenn der Computer die unfaire Entscheidung auswürfelt, sodass wir selbst sie nur akzeptieren müssen… müssen wir gleich etwas härter nachdenken. Und wenn man Menschen alternativ auch die Möglichkeit gibt, Geld zu nehmen, dann sind sie beim Geben gleich weitaus weniger großzügig. Genau genommen reicht es schon, wenn man einfach zu häufig nachfragt. Willst du was abgeben? Willst du was abgeben? Willst du was abgeben? Früher oder später erreicht Freigiebigkeit ihr logisches Ende. Das kann jeder Straßenmagazinverkäufer bestätigen, der als Zweiter eine U-Bahn betritt. Und wie sollte es auch anders sein? Selbst der großzügigste Mensch kann nicht einfach Haus und Hof hergeben und wenn doch, dann eben nur einmal.
Nicht, dass Großzügigkeit keine tolle, unbedingt erstrebenswerte Eigenschaft ist: Sie kann Wunder wirken, besonders im Rahmen von Freundschaften und Familien. Oder bei klar umrissenen Katastrophen. Hungersnöte, Tsunamis, Ahrtal- oder Elbeflut. Da brechen wir Spendenrekorde. Aber unseren Alltag oder gleich eine ganze Gesellschaft nur darauf aufbauen, kann man nicht. Zum Glück haben wir unsere Gesellschaft auch nicht auf Großzügigkeit gebaut. Denn rein menschheitsgeschichtlich geht es bei Verteilung weniger um Verzicht und Abgeben als um Mehrwert.
Zum Verständnis bitte man zwei Schimpansen für eine Belohnung an einem Strang zu ziehen. Beide verstehen die Aufgabe sofort und legen sich ins Zeug … dann isst der Ranghöhere alles auf und der andere ist beleidigt. Das Prinzip funktioniert exakt einmal. Menschenkinder dagegen verstehen, dass man die Beute einer Räuberleiter teilen muss, lange bevor sie freiwillig etwas von ihrer eigenen Kekspackung hergeben.
Teilen lernen
»Teilen« ist die Grundvoraussetzung von Zusammenarbeit, einfach weil die sonst ziemlich abrupt endet. Diese Erkenntnis ist evolutionär gesehen nicht nur unser größter Durchbruch, sondern auch unsere einzige Chance. Menschen jagen in Gruppen, brauchen Bauanleitungen und bekommen Nachwuchs, der anfangs nicht mal seinen Kopf halten kann. Also mussten wir lernen zu teilen. Sozial sein heißt ziemlich oft, gegenseitige Abhängigkeit zu verstehen. Und niemand kann so schön voneinander abhängig sein, wie wir Menschen.
Das große komplexe Gehirn z. B., auf das wir Menschen so stolz sind, könnten wir nicht mal ernähren, wenn uns am Anfang unseres Lebens nicht irgendjemand erklärt, wie das geht. Mit welchem Steinkeil man Fleisch vom Knochen abtrennt, oder wahlweise, wo man Tofu findet. Ohne diese Menschen um uns herum hätten wir wohl auch weit weniger Anlass gehabt, so ein großes Gehirn auszubilden.
Denn unser energiefressendes Denkorgan hat über Millionen Jahre wenig beeindruckende Werkzeuge hervorgebracht – gebraucht haben wir es wohl vor allem, um die Gesellschaft zu koordinieren und zusammenzuarbeiten. Mehr noch, dass dieses Gehirn sich über lange Kleinkindjahre überhaupt so komplex entwickeln und entfalten kann, liegt nur daran, dass ihm in dieser Zeit dutzende Menschen Unterstützung, Liebe und Input geben.
Das Wort Self-Made Man ist insofern irreführend. Niemand ist hier selbst gemacht. Es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Seit Anbeginn unserer Zeit stützen wir uns immerzu auf einen generationenübergreifenden Austausch. Leben mit technischen und medizinischen Wundern, obwohl kein Mensch allein fähig wäre, einen Toaster herzustellen. Und stehen am Ende alle mit einer Zivilisation da, statt alleine mit einer Karotte.
Teilen und Geben
So wurde aus einer Notwendigkeit ein Evolutionsvorteil: Wer teilt, hat mehr, weil die Gruppe mehr schafft als die Summe ihrer Teile. Weil sie Ressourcen effizienter nutzt. Weil sie sich gegenseitig absichert, und dadurch neue Wege geht, auf die Gefahr hin, dass man hin und wieder hungrig zurückkommt. Und nicht zuletzt, weil Wissen immer mehr wird, wenn man es teilt.
Sich in diesen Austausch und diese Wertschöpfung einzubringen, ist auch eine Art des Gebens. Eine, die der Seligkeit vielleicht ein Stück näherkommt. Weil sie so ehrlich ist. Weil sie den Kern dessen anerkennt, was wir sind – eine Spezies, die vom ersten Tag an aufeinander angewiesen ist.
Aus dieser Perspektive macht es Sinn, dass Kinder sozial sind, lange bevor sie großzügig werden. Dass sie Verzicht nicht mögen und dennoch Mehrwert für alle anstreben. Und tatsächlich, wenn sie die Wahl haben, als einziges einen Keks zu bekommen oder durch Teamarbeit jedem ein Stück zu sichern, dann riskieren sie lieber die Teamarbeit.
Auch Erwachsene verteilen Gemeinschaftsgewinn weitaus gekonnter als geschenkte 10 Euro. Weder Gruppendenken noch Ausreden verleiten sie dazu, Leute über den Tisch zu ziehen, die vertrauensvoll mit ihnen zusammenarbeiten. Und, wo Wiederholung unsere Großzügigkeit strapaziert, wird Zusammenarbeit dadurch nur routinierter.
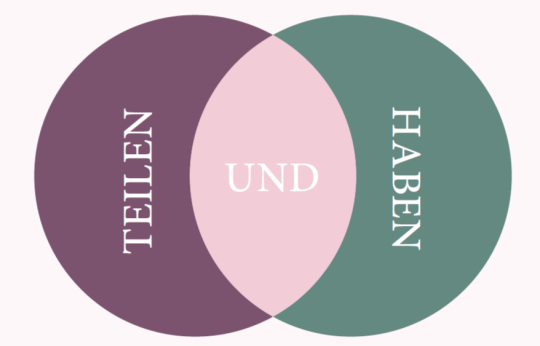
Leistung eine Gegenleistung
Dabei braucht nicht jede Leistung eine Gegenleistung. Stattdessen stellt die Forschung immer wieder überrascht fest, dass Menschen handeln, als gäbe es einen Container der Reziprozität. Sprich, einen sozialen Topf, in den wir einzahlen einfach im Vertrauen darauf, dass wir daraus irgendwann etwas zurückkriegen. Mindestens dann, wenn wir es brauchen. Das Prinzip ist so tief in unserem Denken verankert, dass seine Spuren in Studien immer wieder auftauchen, ganz egal, wie oft die Forschenden betonen, dass die Begegnungen einmalig und anonym sind.
Wenn man sieht, wie stark uns das Netz gegenseitigen Austauschs bindet – oder, dass unser moralisches Empfinden, das bei Großzügigkeit so wackelig war, hier auf einmal glasklar ist – dann, ist es kein Wunder, dass Leute, die nichts abgeben wollen, sehr viel lieber über Großzügigkeit reden, als über die gerechte Entlohnung von Arbeit. Dass sie Millionen spenden und gleichzeitig gegen alles lobbyieren, was Profite fair aufteilt. Wie viel sollen sie denn noch von ihrem Besitz abgeben? Dass wir von dem, was wir schon haben, ungerne abgeben, das kennen wir ja von uns selbst.
Nur ist Jeff Bezos Besitz aber gar nicht vom Himmel gefallen, wie im Experiment die 10 Euro. Er wurde erarbeitet. Von Menschen, die dabei nicht mal besonders gut behandelt wurden, in Kalifornien und in Sachsen. Es ist Gemeinschaftsgewinn, der denen vorenthalten wurde, die ihn mit ihren Händen oder Muskeln hauptsächlich herstellen. Genauso wie der Gemeinschaft, die ihm die Straßen und Flughäfen für Amazon Transporte liefert und Angestellte mit Schulbildung.
Milliarden scheffeln und Mindestlohn zahlen, das ist, als würde man zusammen Mammuts jagen und dann alle anderen mit Karotten nach Haus schicken. Eine Verdrehung all dessen, was menschliche Zusammenarbeit ausmacht. Dass diese unfaire Zusammenarbeit im Gegensatz zu der unserer Schimpansen nicht kollabiert, liegt auch daran, dass wir über die Früchte von Zusammenarbeit reden, als hätte sie niemand gepflanzt, gepflückt und geerntet.
Darüber hinaus liegt es auch daran, dass die Menschheit auf den letzten paartausend Metern ihrer Millionen Jahre langen Entwicklung nicht nur das hilfreiche Prinzip des Besitzes entdeckt hat, sondern auch das sehr viel unhilfreichere, Massen davon über Generationen hinweg zu horten.
Konzentrierter Reichtum schadet
Konzentrierter Reichtum ist das Gegenteil unseres Gebens-und-Nehmens, weil er der Gemeinschaft Ressourcen entzieht, ohne ihr je etwas zurückzuzahlen. Auf einen Trickle-Down-Effekt warten wir seit Jahrzehnten vergeblich. Gleichzeitig hebelt er das Gleichgewicht gegenseitiger Abhängigkeit aus – faire Verhandlungen sind schwer, wenn einer alle Mittel der Welt hat und der andere nichts zu essen. Schon Adam Smith warnte vor Kartellen, die Löhne drücken, mindestens genauso dringlich, wie vor denen, die Preise treiben – doch wir ignorieren diese Mahnung scheinbar genauso geschickt, wie jeden Hinweis auf Nadelöhr und Kamele. Und so arbeiten Menschen inzwischen weltweit zu Lohngefällen, die weit über dem doppelten bis 20-Fachen liegen, das sie eigentlich zu tolerieren bereit wären. Oder dass Wertschöpfung und Gehälter immer weiter auseinanderfließen. Wer die tiefe Ungerechtigkeit daran ausblendet, übersieht auch die gesellschaftliche Sprengkraft, die daraus entsteht.
Denn Ungerechtigkeit schürt die verheerende Seite unserer ausgeprägten sozialen Gefühle: Ohnmacht, Frust, Hass und Schadenfreude. Das, was oft Neidkultur genannt wird, eint eigentlich jede kooperative Spezies – ein feines Gespür, ob am Ende einer mit mehr dasteht. Gegen dieses Gespür anzuarbeiten, weiterzuarbeiten unter Bedingungen, die sich unfair oder abschätzig anfühlen, sorgt für Burnout, Krankheit, und chronischen Stress. Oder es bricht sich irgendwo anders Bahn. Wie in einer Studie zur Reifenfabrik Bridgestone, bei der sich die Härte der Gehaltsverhandlungen in der Reifenqualität ablesen ließ.
Lange ließ sich diese gesellschaftliche Schieflage immerhin dadurch abfedern, dass der wirtschaftliche Aufwind zumindest allen Besserung versprach. Der Kuchen ist nicht gleich verteilt, aber wenn er wächst, wird jedermanns Stück größer. Jetzt fehlt dieser Hoffnungsschimmer genauso wie die Sicherheit durch einen starken Sozialstaat. Dafür steigen die Lebenshaltungskosten. Und Corona und Klima lassen uns für die Zukunft nichts Gutes ahnen. Was vorher schon schief lag, droht ein für alle Mal zu kippen. Um das zu verhindern, müssen wir das Ungleichgewicht in unseren Strukturen angehen und uns auf das konzentrieren, was uns überhaupt erst dazu gebracht hat, fair zu verteilen: Die Aussicht, sonst morgen allein dazustehen.
Fairness lebt von der Freiheit nicht zusammenzuarbeiten. Einen unfairen Deal auszuschlagen. Verteilung wurde weltweit weitaus seltener durch Appelle an Großzügigkeit erreicht als durch Gewerkschaften, Kartellämter und Arbeitsschutz; Sozialversicherungen, Existenzsicherung und Streik. All das, was Verhandlungsverhältnisse ausgleicht.
Wir haben eine Verantwortung
Was wir dagegen nicht zulassen dürfen, ist, dass die Debatten darüber zu solchen über Großzügigkeit abgleiten – nicht nur der der Milliardäre. Wie viele Industriestaaten brüsten sich mit Entwicklungshilfe und profitieren gleichzeitig von Ausbeutung? Wie viele Unternehmen loben ihr gesellschaftliches Engagement und reagieren gleichzeitig irritiert, wenn sich Mitarbeitende Zeit nehmen für Kinder und Familie? Und wie viele Akteure predigen Großzügigkeit, während sie längst nicht all ihre Mitarbeiterinnen anständig bezahlen? Einschließlich einiger kirchlicher Träger.
Dass dabei Fürsorge- und Pflegearbeit besonders oft hintenüberfallen, bringt uns zum letzten Problem mit der Idee, dass wer gibt, immer großzügig hinnimmt, weniger zu haben. Sie lässt alle Gaben an die Gemeinschaft wie Kosten aussehen – ganz egal wie viele Studien uns zeigen, dass es das Wort »Investitionen « besser trifft. Investitionen in Kinder, die unsere Gesellschaft später stützen, in Schulen und Universitäten, die sie später ausbilden. In Erwachsene, die unendlich viel lebendiger, gesünder und kreativer sind, wenn sie sich nicht mit Existenzängsten rumschlagen müssen. In Wissen, Pflege und Gesundheit, Risikoabsicherung und Nahrungsversorgung. All das, was unsere Gesellschaft ausmacht, was uns menschheitsgeschichtlich erst stark gemacht hat, und was heute unterfinanziert oder prekär unter den Tisch fällt. Unter der Überschrift »Sozialausgaben«.
Das gleiche gilt für unsere Lebensgrundlagen – saubere Luft, Wasser und ein lebensfähiges Klima. Das, worüber ich im Buch »Weltrettung braucht Wissenschaft« mit Forschenden aus verschiedensten Fachbereichen gesprochen habe, nur um die gleichen Muster zu entdecken, wie auf der Suche nach der Großzügigkeit in »Teilen und Haben«: Auch beim Schutz von Umwelt und Leben reden wir oft vom Verzicht und Spenden. Fragen, wie viel Klimaschutz kosten darf und was Menschen bereit sind aufzugeben. Als ginge es nicht auch hierbei um Berge an Mehrwert, die uns Pflanzen, Erde und Bienen liefern, und noch viel mehr als das: ums menschliche Überleben.
Und als wäre der falsche Fokus auf das Weniger nicht auch hier wieder im Interesse derjenigen, die nicht nur überproportional viele Ressourcen bunkern, sondern auch überproportional viel CO2 ausstoßen. Uns bleiben wenige Jahre, um etwas an dieser Ungerechtigkeit zu ändern und damit unsere Lebensgrundlagen zu sichern, genauso wie das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Höchste Zeit, dass wir aufhören Phantome zu jagen und uns dem handfesten Fundament zuwenden, auf dem wir stehen: Die unverzichtbare Kunst des Teilens.

DR. FRANCA PARIANEN
ist ausgebildete Neurowissenschaftlerin, Journalistin,
Rednerin und Autorin, beschäftigt sich mit menschlichem
Zusammenleben und der Frage, warum es uns so schwerfällt.